Als Mensch bin ich voller Paradoxien. Und bis zu diesem Interview gab es viele Paradoxa im Zusammenhang mit der finanziellen Unabhängigkeit und der FIRE-Bewegung, die ich aufgrund mangelnder Kenntnisse nicht entwirren konnte – vor allem, weil ich in der Schule keinen Wirtschaftsunterricht hatte.
Wie wäre es mit einem Beispiel? Kann man ein langfristiges Börsenwachstum anstreben, ohne die Wälder zu verbrennen, die man so sehr liebt?
Noch ein anderes? Wäre Schrumpfung nicht besser mit einer frugalistischen Weltanschauung vereinbar?
Treffen mit einem international anerkannten Wirtschaftswissenschaftler
Durch verschiedene Podcasts bin ich auf Jean-Pierre Danthine gestossen. Wer könnte besser auf solche Fragen antworten als ein Wirtschaftsprofessor, der noch dazu ehemaliger Präsident der Paris School of Economics UND ehemaliger Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank ist?
Man könnte meinen, dass man sich zu Tode langweilen und nichts verstehen wird, wenn man mit ihm spricht… aber im Gegenteil, was mir an ihm gefallen hat, ist, dass er die Wirtschaft auf eine Art und Weise erklärt und popularisiert, die für den Normalbürger verständlich ist. Puh!
Und was mich am meisten anzog, war seine Fähigkeit, über Wirtschaft, Kapitalismus, globale Grenzen und so viele andere Dinge zu sprechen, und zwar ausschliesslich auf wissenschaftliche und niemals auf politische Art und Weise!
Los geht’s mit dem Interview.
Vorstellung von Jean-Pierre Danthine
MP: “Kannst du dich in ein paar Sätzen vorstellen?”
Ich bin Jean-Pierre Danthine. Ursprünglich bin ich Lehrer für Makroökonomie und Finanzen. Ich begann meine Karriere mit einigen Jahren Lehrtätigkeit an der Columbia University, bevor ich zur HEC Lausanne wechselte. Anfangs unterrichtete ich dort vor allem Makroökonomie, aber meine Forschung war immer an der Schnittstelle zwischen Makro- und Finanzwissenschaft angesiedelt. So kam es ganz natürlich, dass ich mich nach und nach mehr dem Finanzwesen zuwandte, auch in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Fakultät.
Ich blieb bis Ende 2009 an der HEC Lausanne. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich in die Schweizerische Nationalbank (SNB) berufen. Zunächst übernahm ich die Leitung der dritten Abteilung und wurde dann zum Vizepräsidenten ernannt, der für die zweite Abteilung zuständig war. Dies führte dazu, dass ich Teil des Direktoriums oder der Generaldirektion wurde, dieses Trio von Technokraten, das die Verantwortung hat, die Geldpolitik des Landes zu führen. Diese Position hatte ich bis Mitte 2015 inne.
Danach wurde ich Präsident der Paris School of Economics, ein Amt, das ich bis 2021 sechs Jahre lang innehatte. Parallel dazu war ich auch an die École Polytechnique Fédérale de Lausanne gewechselt, wo ich ein Zentrum namens Enterprise for Society, kurz E4S, gegründet und geleitet habe. Ich leitete es bis Mitte 2023.
Seitdem bin ich ehrenamtlicher Direktor dieses Zentrums. Ich bin jedoch weiterhin voll in die Überlegungen zu seinen Zielen, seiner Mission und den Mitteln, die es mobilisieren kann, eingebunden. Dieses Zentrum, das die EPFL, die Universität Lausanne und das IMD vereint, soll der Gesellschaft dabei helfen, den Übergang zu einer widerstandsfähigeren, inklusiven und nachhaltigen Wirtschaft erfolgreich zu gestalten.
Kapitalismus
MP: “Welches Buch würdest du empfehlen, um sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte des Kapitalismus zu verstehen, und zwar ohne politische Voreingenommenheit?”
Die Antwort ist, dass ich keins kenne. Es gibt natürlich eine echte Frage: Was versteht man unter Kapitalismus? Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen darunter sehr unterschiedliche Dinge verstehen. Meines Wissens gibt es keine anerkannte Definition, zumindest nicht aus der Sicht der Wirtschaftstheorie. In diesem Rahmen wird der Begriff auch nicht wirklich verwendet.
Also, der Kapitalismus… Für einige ist er gleichbedeutend mit Neoliberalismus. Für andere ist es einfach eine Marktwirtschaft. Einige werden eher das Eigentum an Vermögenswerten, das individuelle Eigentum betonen. Aber ich habe keine Definition von Kapitalismus, die besagt, dass es das sein muss.
Ich denke, ich würde sagen, dass das Herzstück des Kapitalismus das Eigentum ist, aber dieses Eigentum muss nicht unbedingt individuell sein, sondern kann auch kollektiv sein. Die Idee ist, dass der Eigentümer sich um das kümmert, was er besitzt, und dass es uns in einer Welt voller Eigentümer am Ende allen besser geht.
Wenn wir eine sehr breite Definition annehmen, kann der Eigentümer die Gemeinschaft, eine Gruppe von Menschen, eine Stiftung… sein. Es kann viele Formen annehmen. Ein anderer Blickwinkel wäre, zu sagen, dass der Kapitalismus eine Form der wirtschaftlichen Organisation ist, die darauf abzielt, das Kapital zu erhalten — das ist ein bisschen die Idee, die sich in der Etymologie des Begriffs wiederfindet. Und in diesem Punkt bin ich ziemlich einverstanden.
Aber für mich ist dieses Kapital nicht nur das physische Kapital — Maschinen, Gebäude usw. —, sondern auch das menschliche Kapital. Es ist auch das Humankapital, das soziale Kapital und das Naturkapital. Wenn ich also sage, dass der Kapitalismus ein System ist, das darauf abzielt, unser kollektives Kapital — sei es physisches, menschliches, soziales oder natürliches Kapital — zu erhalten oder sogar zu entwickeln und zu vermehren, dann ja, dann betrachte ich mich als überzeugten Kapitalisten.
Aber ich kenne kein Buch, das die Stärken und Schwächen dieser Sicht des Kapitalismus klar erklären würde. Also nein, ich habe keine sehr formelle Antwort auf diese Frage.
MP: “Kann es einen Kapitalismus geben, der den Planeten nicht zerstört UND uns nicht bösartig macht?”
Ich habe in gewisser Weise bereits geantwortet, indem ich sagte, dass meine Vision des Kapitalismus diejenige ist, die versucht, das Naturkapital zu erhalten. In einer Welt wie der heutigen, in der das BIP steigt, der Wohlstand zunimmt, das physische Kapital wächst, das Humankapital zunimmt — soweit man es messen kann —, ist das Sozialkapital problematischer. Wir haben eine Welt, die immer stärker polarisiert ist, also gibt es zweifellos Fragen, die man sich auf dieser Ebene stellen muss. Auch wenn es in Wirklichkeit keine sehr klaren Messungen gibt, um es zu bewerten.
Was wir dagegen ganz klar sehen, ist, dass das Naturkapital abnimmt. Und hier haben wir ein echtes Problem, das meiner Definition und meiner Vision von Kapitalismus widerspricht.
Warum gelingt es uns, das Sachkapital und sogar das Humankapital auf natürliche Weise zu entwickeln? Weil hier die Interessen relativ gut aufeinander abgestimmt sind. Beim Naturkapital hingegen ist das nicht unbedingt der Fall. Es gibt sogenannte Externalitäten oder auch “fehlende Märkte”.
Wenn der Kapitalismus auf die Existenz von Märkten angewiesen ist, um richtig zu funktionieren, müssen diese Märkte auch existieren. Ein Markt für die Erhaltung der Natur in 50 Jahren existiert jedoch nicht. Es gibt keinen “natürlichen Markt”. Daher würde ich sagen, dass der Kapitalismus in diesem Bereich ergänzt werden muss. Der Markt muss von einer Intervention begleitet werden — um sicherzustellen, dass auch dieses Kapital erhalten wird. Heute sind wir noch nicht so weit.
Macht der Kapitalismus uns bösartig zueinander? Das ist eine interessante Frage. Wenn wir zu Adam Smith zurückkehren — der im Grunde einer der grossen Denker ist, die das wirtschaftliche Denken im 18. Jahrhundert begründet haben —, dann hat er die Idee der unsichtbaren Hand vertreten, eine äusserst kraftvolle Intuition, die übrigens später durch sehr wichtige Theoreme bestätigt wurde.
Aber in dieser Vision, im Rahmen des Wettbewerbs oder des Marktes, sind Produzenten und Konsumenten Partner. Es gibt eine implizite Form der Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass uns das heute ein wenig entgeht in einem Kapitalismus, der vielleicht über das hinausgewachsen ist, was man sich wünscht, und der vielleicht nicht ausreichend reguliert ist.
Vielem, was ich gerade gesagt habe, liegt zugrunde, dass es eine andere Form der Regulierung geben muss, wenn es keinen Markt gibt. Sie muss von der Gemeinschaft, vom Staat oder von einer anderen Vertretung der Gemeinschaft kommen. Ein unzureichend regulierter Kapitalismus kann tatsächlich zu Antagonismus, Polarisierung, und zu dem Gefühl führen, dass das System uns bösartig gegeneinander macht. Für mich ist das eine Perversion einer richtig verstandenen kapitalistischen Organisation.
Aktienmärkte
MP: “Warum sagt man, dass sich die Märkte immer wieder erholen?”
Ich glaube, die wahre Antwort ist, ohne ins Detail zu gehen, dass der Markt dem Wachstum der Wirtschaft folgt. Wenn du einen Indikator wie die gesamte Marktkapitalisierung geteilt durch das weltweite BIP nimmst, erhältst du etwas, das Statistiker wahrscheinlich als stationär bezeichnen würden.
Dann gibt es starke Schwankungen. Zeitweise kommt es zu Höhenflügen an den Börsen und dann wieder zu Crashs. Die Realwirtschaft hingegen ist viel stabiler. Aber in den letzten 200 Jahren ist sie stetig gewachsen. Wenn man also den Zusammenhang herstellt, bedeutet das, dass der Markt langfristig der Entwicklung der Realwirtschaft folgt. Und solange wir in einer wachsenden Realwirtschaft bleiben, können wir, wenn wir geduldig genug sind, davon ausgehen, dass sich der Markt irgendwann wieder erholt.
Die Realität ist, dass diese Erholung manchmal sehr lange dauern kann. Es gab Zeiten von 20 Jahren, in denen man an den Aktienmärkten nichts verdient hat. Das ist einfach passiert. Wenn deine Geduld also sehr gross ist — sagen wir in der Grössenordnung von 50 Jahren, seit der industriellen Revolution — kannst du tatsächlich sagen, dass sich die Märkte irgendwann erholen.
Danach ist das nicht unbedingt etwas, was für jemanden in meinem Alter zum Beispiel sehr komfortabel ist. Mein Horizont ist vielleicht nicht so lang. Aber es ist trotzdem die Realität.
MP: “Warum gibt es Zeiten des Crashs (Bear) und Zeiten des Aufschwungs (Bull)? Kannst du das so erklären, als ob du mit meinem 15-jährigen Kind sprechen würdest?”
Ich denke, der Schlüsselpunkt ist, dass das Marktniveau von dem abhängt, was die Wirtschaft heute produziert, aber vor allem von dem, was wir erwarten, dass sie in Zukunft produzieren wird. Und hier betreten wir einen Bereich der Unsicherheit. Es werden Erwartungen geäussert: Wird sich dieses Unternehmen auch in einem Jahr oder in fünf Jahren noch gut entwickeln? Wird sich ein Unternehmen, das sich heute in Schwierigkeiten befindet, wieder erholen können?
Man konzentriert sich also auf einen Zeithorizont von einem, drei, fünf oder sogar zehn Jahren.
Da wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, können wir manchmal optimistisch sein, manchmal aber auch nicht. Was tatsächlich passiert, ist, dass man, wenn man sich in einer optimistischen Stimmung befindet, dazu neigt, optimistisch zu bleiben. Und wenn eine pessimistische Stimmung herrscht, neigst du dazu, pessimistisch zu bleiben.
Die Märkte haben also diese Neigung, Phasen zu durchlaufen: Phasen des Optimismus, des Aufschwungs, die man auf Englisch als “Bull”-Phasen bezeichnet. Und dann ist es plötzlich wie bei einem Ballon: Etwas sticht ihn an, und er verliert die Luft. Dann stellt man fest, dass man sich zu sehr auf etwas gefreut hat, das man für fantastisch hielt, das aber in Wirklichkeit gar nicht so fantastisch war. Schlimmer noch, es gibt ein Ereignis, das alles verändert.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Alles schien gut zu laufen, doch dann begann ein Mann namens Trump, katastrophale Entscheidungen zu treffen. Man dachte, alles sei in Ordnung, doch dann trifft dieser Mann Entscheidungen, die für alle Beteiligten das Gegenteil bedeuten: Instabilität. Und so bricht der Markt zusammen (“Bear” auf Englisch).
MP: “Warum sagt man, dass die Märkte “langfristig immer” steigen? Kann man das wirtschaftlich wirklich belegen?”
Das hängt stark vom Wachstum der Wirtschaft ab. Wir leben in einer Welt, in der man anfängt, dieses Wachstum in Frage zu stellen.
Diese Fragen hängen zum Beispiel damit zusammen, dass man heute, wenn man die Realität wirklich sehen will, spürt, dass sich der Faktor Globalisierung — der doch mit einem gewissen Vertrauen der einen in die anderen verbunden war — gerade verändert.
Vorhin war von Böswilligkeit die Rede, aber lange Zeit herrschte ein grundlegendes Vertrauen: Man konnte sich spezialisieren, jeder in seinem Bereich. Das bedeutete, dass man akzeptieren musste, dass man nicht alles alleine machen konnte, aber dass man durch globale Zusammenarbeit ein viel besseres Ergebnis erzielen konnte, als ob jedes Land alles im Alleingang machen wollte.
Seit den 1980er und 1990er Jahren hat sich diese Phase der Globalisierung äusserst positiv auf das Wirtschaftswachstum ausgewirkt. Heute ist eine Umkehrung zu beobachten: Aus geopolitischen, aber auch aus ideologischen Gründen tritt man in eine Phase der Fragmentierung ein. Man demontiert schrittweise Strukturen, von denen bekannt ist, dass sie das Wachstum lange Zeit unterstützt haben.
Logischerweise sollte dies das Wachstum weniger dynamisch machen und sogar zu Phasen der Stagnation führen… und vielleicht sogar zu einer gewissen Zeit der Schrumpfung.
Und natürlich hätte dies Auswirkungen auf die Märkte, aus den Gründen, die ich bereits erwähnt habe.
MP: “Wie wirkt sich die Berücksichtigung von Umweltfragen auf diese Aussage aus? (die Tatsache, dass die Wirtschaft immer noch wächst)”
Das ist gut, denn in der vorherigen Frage habe ich tatsächlich eher von einer kurzfristigen Perspektive gesprochen, mit der Deglobalisierung. Wenn man eine längerfristige Perspektive einnimmt, dann geht es um Umweltfragen.
Es gibt zwei extreme Szenarien — und wir werden uns wahrscheinlich irgendwo dazwischen befinden. Das erste ist das Szenario, in dem wir nichts tun: Wir machen weiter wie bisher. In diesem Fall werden die globale Erwärmung, klimabedingte Katastrophen, der Verlust der Bodenproduktivität … all das wird unsere Fähigkeit, in Zukunft Wachstum zu generieren, beeinträchtigen. Das könnte zu Stagnation oder sogar zu Schrumpfung führen.
Das andere Szenario ist, dass wir den Stier bei den Hörnern packen und die Erwärmung, die Klimakatastrophen, den Verlust der Biodiversität und den Rückgang der Bodenproduktivität in Angriff nehmen. Wir wissen, dass die Technologie uns bei diesem Übergang helfen wird… aber sie allein wird uns nicht bis zum Ziel bringen.
Das bedeutet, dass wir in manchen Fällen vielleicht akzeptieren müssen, unseren Konsumdrang ein wenig zu bremsen. Und das könnte sich auf das gemessene Wachstum auswirken — auf das BIP, kurz gesagt.

Der Étang de la Gruère <3 — wenn du noch mehr solcher Orte in der Schweiz kennst, nehme ich das gerne an! (Bildnachweis: j3l.ch © Gerry Nitsch)
Ich gebe dir ein konkretes Beispiel: die Mobilität mit der Luftfahrt. Heute ist dieser Sektor in voller Entwicklung. Er hat sich erholt und ist immer noch da. Wir sind sogar wieder über dem Niveau vor dem Covid. Wenn du dir die Zahlen der Flugzeugproduktion bei Boeing oder Airbus ansiehst, ist das beeindruckend. Die Zahlen im Zusammenhang mit den Flughäfen ebenfalls. Nur ist das alles völlig unvereinbar mit der Einhaltung der planetaren Grenzen.
Wenn man sich also wirklich dazu entschliessen würde, den Stier bei den Hörnern zu packen, würde das bedeuten, zu akzeptieren, dass wir weniger fliegen werden.
Es gibt verschiedene Wege, dies zu erreichen. Aber wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen würden, würden wir weniger fliegen. Das würde bedeuten, dass die Luftfahrtindustrie — Airbus, Boeing — weniger Flugzeuge herstellen und weniger Löhne zahlen würde. Was ist mit den Flughäfen? Dasselbe gilt für sie. Natürlich würde das Geld in andere Bereiche der Wirtschaft fliessen. Aber ein ganzer Teil der Wirtschaft, dieser Sektor, würde stagnieren oder sogar schrumpfen.
Ich muss sagen, dass ich nicht sehr daran glaube — leider. Aber theoretisch kann man gut sehen, dass die Auswirkungen auf das Wachstum negativ sein könnten.
Wirtschaftswachstum
MP: “Ist Wirtschaftswachstum notwendigerweise mit materiellem Konsum verbunden? Was ist die Verbindung zwischen den beiden (wenn es eine gibt)?”
Zuerst muss man verstehen, dass die Wachstumszahlen im Wesentlichen damit zusammenhängen, dass wir mit denselben Ressourcen mehr schaffen. Mit anderen Worten: Wachstum könnte dadurch entstehen, dass wir immer mehr arbeiten oder immer mehr Maschinen einsetzen, um das zu produzieren, was wir produzieren wollen.
Es stimmt, dass es Wachstum geben würde, wenn es immer mehr Maschinen gäbe — so sagt es die Wirtschaftstheorie. Aber das wäre Unsinn. Denn Maschinen, sie verlieren an Wert. Wenn du zu viele Maschinen hast, wird es irgendwann sehr teuer, sie instand zu halten und zu ersetzen. Es ist ein bisschen wie mit den Strassen im Wallis: Wenn man zu viele Strassen baut, wird der Unterhalt nach einer Weile zu teuer. Dann sagt man sich, dass man zu weit gegangen ist.
Dasselbe gilt für die Wirtschaft im Allgemeinen. Wenn man zu viele Maschinen hat, macht es keinen Sinn mehr. Und auf makroökonomischer Ebene stellt man fest, dass in den entwickelten Ländern oder in den Ländern, die einen sogenannten “steady state” — ein gewisses Gleichgewicht — erreicht haben, das Wachstum nicht mehr dadurch zustande kommt, dass man mehr materielle Dinge hat. Es kommt daher, dass man bessere Ideen hat.
Und wenn man das versteht, erkennt man auch, dass der Konsum im BIP zunehmend immateriell ist. Und die Zukunft wird wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Wir haben bereits viele Computer — brauchen wir doppelt so viele pro Person? Die Antwort lautet: Nein. Es gibt sogar eine Tendenz zur Konzentration der Geräte. Wir sind von einer Zeit, in der viele Menschen zwei Autos hatten, zu einer Zeit gekommen, in der das für viele keinen Sinn mehr macht.
Dennoch steigen die Einkommen weiter an. Und diese Einkommen werden immer mehr für immaterielle Ausgaben verwendet: Kultur, Reisen, Pflege… Dinge, die nicht materiell sind.
Also, die Antwort ist nein: Wirtschaftswachstum muss nicht unbedingt mehr Konsum bedeuten. Wir haben in unseren Industrieländern wahrscheinlich sogar einen absurden Punkt erreicht, an dem der materielle Konsum so heilig ist, dass wir immer mehr davon haben wollen — obwohl wir sehen, dass es nicht zu unserer Zufriedenheit und unserem Glück beiträgt. Das ist ein kulturelles Problem.
Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es keinen Hinweis darauf, dass zwei iPhones dich glücklicher machen oder dass du unbedingt jedes Jahr ein neues iPhone kaufen musst. Das macht keinen Sinn.
Also nein, Wachstum bedeutet nicht unbedingt mehr materiellen Konsum — das ist sehr klar.
Nun, wie können wir das Tempo ändern? Vielleicht ist deine Bewegung ein Weg, um das zu tun: Sich zu sagen, dass man ein bisschen sparsamer sein kann, und zu erkennen, dass man dadurch nicht unglücklicher wird. Vielleicht kann man sogar etwas weniger arbeiten oder sein Geld anders verwenden. Und all das ist absolut vereinbar mit Wirtschaftswachstum. Es ist sogar vollständig mit der Wirtschaftstheorie vereinbar, die nie gesagt hat, dass das Ziel darin besteht, das Wachstum zu maximieren.
MP: “Was ist dein Standpunkt zu Degrowth? Oder anders gefragt: Ist Wachstum etwas Schlechtes?”
Es stimmt, dass die Degrowth-Bewegung von einer anderen Sichtweise ausgeht. Es geht nicht um die Frage “Was wollen wir erreichen?”, sondern eher um die Frage “Was müssen wir tun, um die Grenzen unseres Planeten zu respektieren?” Es ist diese Vorstellung, dass die Ressourcen begrenzt sind. Nur ein etwas utopischer Wirtschaftswissenschaftler würde glauben, dass das Wachstum unendlich sein könnte.
Aber ich habe ein wenig darauf geantwortet: Wachstum ist nicht unbedingt an materielle Ressourcen gebunden. Es entsteht auch durch unsere Fähigkeit, mit denselben Ressourcen oder sogar mit weniger mehr zu erreichen. Die Idee, dass “endliche Ressourcen gleich unmögliches Wachstum” bedeutet, ist also nicht unbedingt wahr. Die wahre Frage ist, ob wir die globalen Grenzen respektieren müssen. Und hier komme ich auf das zurück, was wir am Anfang gesagt haben: Wir müssen unser Naturkapital unbedingt bewahren, für uns selbst und für die zukünftigen Generationen.
Die heutige Technologie erlaubt es uns nicht, dies mit dem “Business as usual” zu tun. Es muss sich also etwas ändern. Es gibt eine pessimistische Sichtweise, die besagt, dass die einzige Lösung Schrumpfung ist — weil Wachstum zu viel Konsum, zu viel Umweltverschmutzung bedeuten würde. Wenn wir also schrumpfen, werden wir in die richtige Richtung gehen.
Ich denke, dass man da ein bisschen agnostisch sein muss. Für mich ist das Ziel nicht, zu schrumpfen. Das Ziel ist, die planetarischen Grenzen zu respektieren. Man muss intelligent sein, aufhören, sinnlos materielle Güter zu konsumieren, aufhören zu denken, dass man immer mehr arbeiten muss, um mehr zu verdienen und mehr zu konsumieren.
Werden wir das schaffen? Ich weiss es nicht. Aber eines ist sicher: Die Grenzen des Planeten zu respektieren ist ein Muss. Und wenn wir es klug anstellen, glaube ich, dass wir weiter wachsen können — zumindest, wenn wir das Wachstum richtig messen. Das Ziel ist nicht, zu schrumpfen. Das Ziel ist es, die planetaren Grenzen zu respektieren, intelligent zu sein, unser Wohlstandsniveau zu erhalten und zukünftigen Generationen zu ermöglichen, das gleiche Wohlstandsniveau zu geniessen. Das scheint mir klar zu sein.
Das Ziel ist nicht, zu schrumpfen. Das Ziel ist es, die planetarischen Grenzen zu respektieren, intelligent zu sein, unser Wohlstandsniveau zu erhalten und zukünftigen Generationen zu ermöglichen, das gleiche Wohlstandsniveau zu geniessen.
Wird uns das zu einer Schrumpfung führen? Ich denke nicht, dass dies auf lange Sicht der Fall sein wird. Wird es Phasen geben, in denen sich das Wachstum verlangsamt? Wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Einhaltung der planetaren Grenzen, dann ja, zweifellos.
Ich habe die Luftfahrt als Beispiel genannt: Wenn weniger geflogen wird, wird das Auswirkungen haben. Ja, es könnte Phasen geben, in denen das Wachstum verlangsamt oder sogar negativ ist. Und selbst heute ist das Wachstum manchmal negativ, also könnte das auch in diesem Zusammenhang der Fall sein.
Performance und Diversifizierung beim Investieren
MP: “Kann man noch mit einer durchschnittlichen annualisierten Performance von 7 % für einen Welt-ETF rechnen und dabei die globalen Grenzen beachten? Warum ist das so? Und wenn nicht, welche Rendite (%) kann man erwarten?”
Das, was ich gerade gesagt habe, bedeutet, dass ich keine sehr genaue Antwort geben kann. Ich denke, wenn man mit einer durchschnittlichen Rendite von 7 % rechnen könnte, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, wäre das wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Das würde bedeuten, dass wir nicht das tun, was wir tun müssen, um die planetaren Grenzen einzuhalten. Denn gerade die Einhaltung dieser Grenzen müsste in einigen Bereichen eine Verlangsamung bedeuten.
Warum ist das so? Weil die Technologie, die wir brauchen würden, noch nicht verfügbar ist. Das ist so. Aber es ist auch möglich, dass wir nichts tun und noch eine Weile diese Art von Ertrag haben werden.
Was wird dann passieren? Wir werden eine globale Erwärmung, Katastrophen, grosse Bevölkerungsbewegungen und immer weniger produktive Böden haben. All das wird letztendlich zu niedrigeren Erträgen führen.
Ich würde also sagen, dass wir uns in einer Welt befinden, in der wir vor einer Gabelung stehen. Ob wir nun nach links oder rechts gehen, mittelfristig würde ich nicht auf Erträge setzen, die mit denen vergleichbar sind, die wir beispielsweise in den letzten 30 Jahren hatten.
Welche Zahl soll man jetzt nennen? Ich weiss es nicht. Das hängt von unserer Fähigkeit ab, intelligent mit all dem umzugehen.
Es ist nicht nur eine Frage der Technologie. Ja, es gibt technologische Innovationen, die uns helfen können, aber es geht auch um die Art und Weise, wie wir das alles regieren, um die menschliche Führung, die allgemeine Führung. Und da kann man es entweder dumm machen oder versuchen, es ein bisschen intelligenter zu machen.
MP: “Für einen durchschnittlichen Schweizer empfehle ich, in einen Welt-ETF zu investieren, um so diversifiziert wie möglich zu sein (Risikoreduzierung) und gleichzeitig die bestmögliche Performance zu erzielen.
Was ist deine Sicht als Ökonom auf ein solches Portfolio, einschliesslich der Umweltfragen?
Mein Standpunkt als Ökonom — genauer gesagt als Finanzprofessor — ist ganz klar: Maximale Diversifizierung ist das Einzige, was ein einzelner Investor wirklich tun kann.
Die maximale Diversifizierung ist das Einzige, was ein einzelner Anleger wirklich tun kann.
Versuche nicht, Market-Timing zu betreiben, versuche nicht, Stock-Picking zu betreiben. Maximale Diversifizierung ist wirklich der richtige Ausgangspunkt. Das ist die Grundstrategie, auf die wir uns stützen sollten.
ESG-Investitionen, gut oder schlecht?
MP: “Sind ESG-ETFs ein gutes Anlagevehikel (aus wirtschaftlicher Sicht)?”
Ja… Ich würde gerne mit Ja antworten, aber heute sind wir nicht sehr überzeugt von der Art und Weise, wie ESG-ETFs umgesetzt wurden. Daher fällt es mir etwas schwer, dir zu sagen, dass du ESG-ETFs einem globalen ETF vorziehen solltest.
Ich denke, dass es, insbesondere wenn du ein Umweltbewusstsein hast, vielleicht sinnvoller wäre, einen globalen ETF für, sagen wir, drei Viertel deines Portfolios zu bilden. Und von den restlichen 25 % solltest du dich auf Anlagen konzentrieren, die wirklich positive Auswirkungen auf den Übergang zu einer neuen Wirtschaftsform haben. Aber das ist nicht einfach, muss ich zugeben. Und ich finde, dass in dieser Hinsicht von den Finanzanbietern — die gerade Anlegern wie dir und mir helfen sollten — noch nicht genug getan wird.
Es ist wie ein Teufelskreis: Die Vermittler sagen, dass sie nicht mehr Optionen anbieten, weil es noch nicht genug Nachfrage gibt. Und sie haben ihrerseits auch eine treuhänderische Pflicht: Ihr Ziel ist es, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen, die heutzutage vor allem auf Rendite aus sind. Viele Menschen wären bereit, nachhaltiger zu investieren, aber nur, wenn ihnen garantiert wird, dass ihre Rendite nicht darunter leidet. Und heute ist es aus offensichtlichen Gründen sehr schwierig, dies zu garantieren.
Die Welt entwickelt sich weiter. Wir haben es gesehen: Eine Reihe von ESG-ETFs haben zum Beispiel den Öl- und den fossilen Energiesektor ausgeschlossen. Als die Preise für fossile Brennstoffe jedoch stark anstiegen, gerieten diese ETFs gegenüber ihren Kunden in Schwierigkeiten. Dasselbe gilt z. B. für die Rüstungsindustrie.
Es ist also überhaupt nicht offensichtlich. Und ich glaube, dass die Vermittler noch keine wirklich überzeugende Lösung gefunden haben, die es Anlegern, die nicht ihre ganze Zeit damit verbringen wollen, ermöglichen würde, wirklich sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
Es gibt jedoch eine Frage, die man sich stellen kann. Wir leben heute in einer extrem unsicheren Welt. Und die Frage ist: So sehr die Strategie, die du vertrittst — 100 % investieren und dann vergessen — in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, so sehr kann man sich heute fragen, ob wir nicht vor einem echten Paradigmenwechsel stehen. Vielleicht solltest du eine kleine, sichere Anlagetasche für den Fall haben, dass die Dinge wirklich schlecht laufen.
Und hier habe ich keine fertige Antwort. Das ist eine sehr schwierige Frage. Denn das Problem, mit dem wir heute als klare Investoren konfrontiert sind, ist, dass es enorme Risiken gibt, die sich vielleicht nie materialisieren. Diese Risiken werden als Niederfrequenzrisiken bezeichnet.
Wie kann man sich vor diesen Risiken schützen? Das Problem ist, wenn du versuchst, dich vor ihnen zu schützen, und sie sich nicht materialisieren, wirst du ein Verlierer sein. Und zwar für eine sehr lange Zeit, weil es sich um seltene Risiken handelt.
Ich glaube also, dass dies eine Frage ist, die man irgendwo im Hintergrund haben muss. Und es kann dazu führen, dass man sich sagt, dass bestimmte Empfehlungen, die in der Vergangenheit sehr relevant waren — und bislang gut funktioniert haben — in Zukunft vielleicht nicht mehr so gut funktionieren.
Divestment-Strategie?
MP: “Ist eine Desinvestitionsstrategie (Ausschluss bestimmter Industrien/Unternehmen) wirksam, um als Privatanleger Umweltziele zu unterstützen?”
Die Antwort ist nein. In der Tat gibt es nur sehr wenige Beispiele dafür, dass eine Veräusserungsstrategie wirklich effektiv war.
Wenn hinter einer solchen Strategie die Idee steht, dass man “den Hahn zudreht”, dass man bei einer Investition einem Unternehmen Geld gibt, damit es Dinge tut, die einem nicht gefallen, und dass man, wenn man nicht mehr investiert, das Unternehmen daran hindert, weiterzumachen, dann funktioniert das nicht wirklich so.
Denn wenn du etwas verkaufst, gibt es zwangsläufig jemand anderen, der es kauft. Und selbst wenn ein Unternehmen im Extremfall nicht mehr über die Börse finanziert werden könnte, hat es immer noch Zugang zu anderen Quellen: private Märkte, Anleihemärkte, Bankkredite. Es gibt unzählige Alternativen.
Damit eine solche Strategie wirklich etwas bewirken kann, müssten alle Investoren zustimmen. Aber das ist völlig illusorisch.
In Wirklichkeit beobachten wir, dass Desinvestitionsstrategien vor allem dazu dienen, das eigene Gewissen zu beruhigen. Man fühlt sich besser, wenn man sie anwendet, aber sie sind an sich nicht effektiv. Und oft führen sie zu unausgewogenen Portfolios, in denen man andere Risiken eingeht, als man es normalerweise tun würde.
Desinvestitionsstrategien dienen vor allem dazu, das eigene Gewissen zu beruhigen. Sie sind an sich nicht effektiv.
Sie sind daher nicht der richtige Weg. Der beste Weg ist es, einem Investorenclub beizutreten, der konkret handelt, indem er in Verwaltungsräten sitzt, auf Hauptversammlungen spricht und die Strategie des Unternehmens beeinflusst, um es in eine andere Richtung zu lenken.
Das kann ein einzelner Investor nicht alleine tun. Das muss gemeinsam geschehen.
Finanzielle Bildung und Umweltprobleme
MP: “Wie kann Bildung in persönlichen Finanzen (Budget, Sparen, Investieren usw.) zur Lösung von Umweltproblemen beitragen?”
Ich denke, es ist wichtig, dass es ein Mindestmass an finanzieller Bildung gibt. Vor allem die Grundidee der Diversifizierung von Investitionen ist absolut wichtig. Sie ist Teil einer Form von Demut: Wir wissen so wenig, dass wir uns darauf einlassen müssen, uns zu diversifizieren.
Und das erfordert ein gewisses Mass an Bildung, vor allem angesichts einiger Betrügereien oder Werbungen, die man sehen kann. Man sieht immer wieder Leute, die alle ihre Eier in einen Korb gelegt haben — einen Korb, der oft von jemandem angeboten wird, der nicht unbedingt ehrlich oder auch nur kompetent ist, aber sich sehr gut ausdrücken kann. Solche Situationen zu vermeiden, ist natürlich entscheidend für deine finanzielle Gesundheit.
Wenn man seine Finanzen schlecht verwaltet hat, wird das Ende des Monats im Vordergrund stehen. Aber wenn man seine Geschäfte gut geführt hat, ist man vielleicht in der Lage, mehr über diese globalen Herausforderungen nachzudenken — einschliesslich des Weltuntergangs..
Und dann, wenn du erst einmal eine gesündere finanzielle Situation aufgebaut hast, bist du wahrscheinlich eher in der Lage, dich anderen Herausforderungen zu öffnen, wie z. B. Umweltproblemen — über das blosse finanzielle Überleben hinaus.
Man sagt oft, dass es einen Konflikt zwischen “dem Ende der Welt” und “dem Ende des Monats” gibt. Wenn du deine Finanzen schlecht verwaltet hast, wird das Ende des Monats Vorrang haben. Aber wenn du deine Geschäfte gut geführt hast, bist du vielleicht in der Position, mehr über diese globalen Herausforderungen nachzudenken — einschliesslich des Weltuntergangs.
Genügsamkeit vs. Wachstum (um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen)
MP: “Was denkst du über das Paradoxon der finanziellen Unabhängigkeit (FI), das einen bewussten Konsum fördert (keine unnötige materielle Anhäufung, Genügsamkeit und die Suche nach einem glücklicheren und reicheren Leben), während es sich auf den Kapitalismus und den Aktienmarkt verlässt, um ein freies Leben zu finanzieren (= nicht für Geld arbeiten zu müssen, nicht “nicht arbeiten / nichts am Strand tun”) — wo Wachstum notwendig ist?”
Ich glaube, dass Wachstum nützlich ist, natürlich, es macht die Dinge einfacher.
Aber man kann sich mit einem Lebensstandard, wie wir ihn in der Schweiz haben, sehr gut auch mit minimalem Wachstum gut funktionieren kann. Wir befinden uns übrigens bereits ein wenig in dieser Situation. Das Pro-Kopf-Wachstum in der Schweiz ist nicht sehr hoch, wenn man es mit den 5, 7 oder 8 % vergleicht, die man in China beobachten konnte, das immer noch ein Entwicklungsland ist.
Ich denke, der wichtige Punkt ist, dass man eine Wirtschaft organisieren kann — eine kapitalistische Wirtschaft, die auf dem Markt basiert und an der Börse funktioniert — die durchaus mit einem bescheidenen Wachstum vereinbar ist. Und sie ist absolut nicht unvereinbar mit einem überlegteren Konsum, mit Genügsamkeit.
Es wäre vielleicht eine etwas andere Wirtschaft als die, die wir heute kennen, aber es ist durchaus machbar.
Noch einmal: Ich unterscheide zwischen der gängigen Sicht auf den Kapitalismus, die oft missverstanden wird, und der von mir vorgeschlagenen Sicht, die viel näher an der Wirtschaftstheorie ist. Und die besagt, dass Wachstum kein Ziel an sich ist. Es ist ein Mittel, ein Traum, ein Ergebnis unserer Vorstellungskraft, unserer Fähigkeit, es besser zu machen.
Aber es ist kein Ziel an sich. Das Ziel ist genau das: ein glücklicheres, reicheres Leben zu führen.
MP: “Ist passives Einkommen (Renteneinkommen) aus Investitionen (eine der Säulen der FIRE-Bewegung) unvereinbar mit den ökologischen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt?”
Passives Einkommen… Du meinst Renteneinkommen, wie es klingt? Ist es das? Statt Arbeitseinkommen?
Ja, also nein, ich denke nicht, dass das unvereinbar ist. Es stimmt, dass nicht jeder von einem Renteneinkommen leben kann. Es muss Menschen geben, die arbeiten. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, denn in einer bequemen Gesellschaft wie der unseren neigt man vielleicht ein bisschen zu sehr dazu zu glauben, dass das Geld von den Bäumen fällt und man sich nur bedienen muss.
Nein, es gibt Menschen, die arbeiten müssen. Wert muss geschaffen werden. Sie wächst nicht auf Bäumen. Ich glaube also, dass man ein gewisses Gleichgewicht halten muss. Sich vorzustellen, sein ganzes Leben lang nur von einem passiven Einkommen leben zu können, bedeutet, von der Arbeit früherer Generationen abhängig zu sein. Es ist schön, davon zu profitieren, aber es ist nicht nachhaltig in grossem Massstab.
Ich denke, dass so viel wie möglich jeder seinen Beitrag zu dieser kollektiven Anstrengung leisten sollte, die darin besteht, Werte für die Gesellschaft zu schaffen. Natürlich hat jeder seine eigenen Neigungen, Fähigkeiten und Eigenschaften. Aber ein Beitrag kann auch dadurch geleistet werden, dass man Kapital zur Verfügung stellt, weil man zum Beispiel besonders genügsam war. Kapital zur Verfügung zu stellen ist auch eine Form des Beitrags. Es gibt also nicht nur Arbeit, es gibt auch Kapital, finanzielle Mittel.
Aber ich denke, dass wir in einer Zeit angekommen sind, in der wir vielleicht etwas zu leicht davon ausgehen, dass alles weiterhin gut laufen wird, auch wenn wir nichts beitragen. Wir sind mit dieser Vorstellung etwas selbstgefällig geworden. Und ich denke, dass wir in eine Phase eintreten, in der dies wahrscheinlich in Frage gestellt werden wird.
Manchmal denkt man, dass es ausreicht, die Reichen zu besteuern, und dass dies das Problem lösen wird. Aber das ist nicht wahr. Es braucht eine kontinuierliche Wertschöpfung. Und in einer Welt, die heute etwas weniger kooperativ ist als früher, sind einige der Vorteile, von denen wir in der Vergangenheit profitiert haben, nicht mehr vorhanden. Das sollte uns dazu veranlassen, etwas proaktiver zu sein und sicherzustellen, dass jeder seinen Beitrag zu dieser kollektiven Anstrengung leistet.
MP-Notizen
Ich bin Materialist UND Kapitalist!
Als ich den Film “Minimalismus” (auf Netflix verfügbar) gesehen habe, hat mich der Kommentar der Wirtschaftswissenschaftlerin Juliet Schor angesprochen:
Wir sind zu sehr Materialisten im alltäglichen Sinne des Wortes und nicht genug im wahren Sinne des Wortes. Wir müssen echte Materialisten sein, d.h. uns wirklich um die Materialität von Gütern kümmern.
Seitdem betrachte ich mich als Materialist. Das ist provokant und löst in meinem Umfeld interessante Gespräche aus.
Nach meiner Diskussion mit Jean-Pierre Danthine kann ich diese Aussage nun ergänzen: *Ich bin Materialist UND Kapitalist”.
Denn wenn wir wollen, dass unsere Wirtschaft über Hunderte von Jahren Bestand hat, muss jeder Geschäftsinhaber (einschliesslich seines Grund und Bodens und seiner Nutzung natürlicher Ressourcen) sein Kapital hegen und pflegen.
Das passt sehr gut zu meinem frugalen Lebensansatz, bei dem du bewusst und qualitativ hochwertig einkaufst. Du kaufst materielle oder immaterielle Güter (denn auch das Immaterielle hat Auswirkungen auf die Natur), die für die Ewigkeit gemacht sind.
Bye bye Temu und Shein, hallo sparsamer Lebensstil!
Und all diese Überlegungen stehen nicht im Widerspruch zum Wirtschaftswachstum und zur Steigerung des Glücks der Menschen, ganz im Gegenteil! Ich denke, ich werde den Blog noch eine ganze Weile weiterführen (nein, nein, das habe ich nicht bezweifelt, aber diese Auffrischung mit einer globalen Perspektive ist sehr willkommen).
Kennst du ein gutes Buch über den Kapitalismus?
Ich kann nicht glauben, dass es kein gutes Buch über den Kapitalismus gibt, ohne dass es schon im Vorwort politisch wird… Ich habe selbst nicht viel gesucht, ich habe mich auf Jean-Pierre verlassen ;)
Was auch immer passiert, wenn du ein solches Buch auf Lager hast, kontaktiere mich bitte per E-Mail oder über die Kommentare.
Produzenten und Konsumenten sind Partner!
Apropos globale Perspektive: Mir hat der Teil gefallen, in dem Jean-Pierre über wirtschaftliche Beziehungen spricht.
Jedes Unternehmen sollte einen echten Mehrwert schaffen, als wäre es ein Partner seiner Verbraucher und nicht ein Extraktor, der seine Gewinne maximieren will, ohne viel über die Konsequenzen (Ethik, Umwelt, Integrität usw.) nachzudenken, nach dem Motto: Hauptsache absahnen – und dann tschüss.
Ich denke hier insbesondere an Werbeagenturen wie Meta, Tiktok und andere Temu und Shein.
Wenn ich das Beispiel des Blogs nehme, dann passt das zu meiner langfristigen Strategie vs. die Anfragen für Werbeplatzierungen oder schlechte Links, die ich jeden Tag bekomme, zu akzeptieren… und doch gäbe es einen Haufen Geld zu verdienen, und ich kann dir sagen, dass ich bereits finanziell unabhängig wäre. Na ja, nein, nicht wirklich. Ich denke, dass ich keine Leser mehr hätte und dass ein solch kurzfristiger Ansatz meinen Blog schon vor langer Zeit zum Erliegen gebracht hätte.
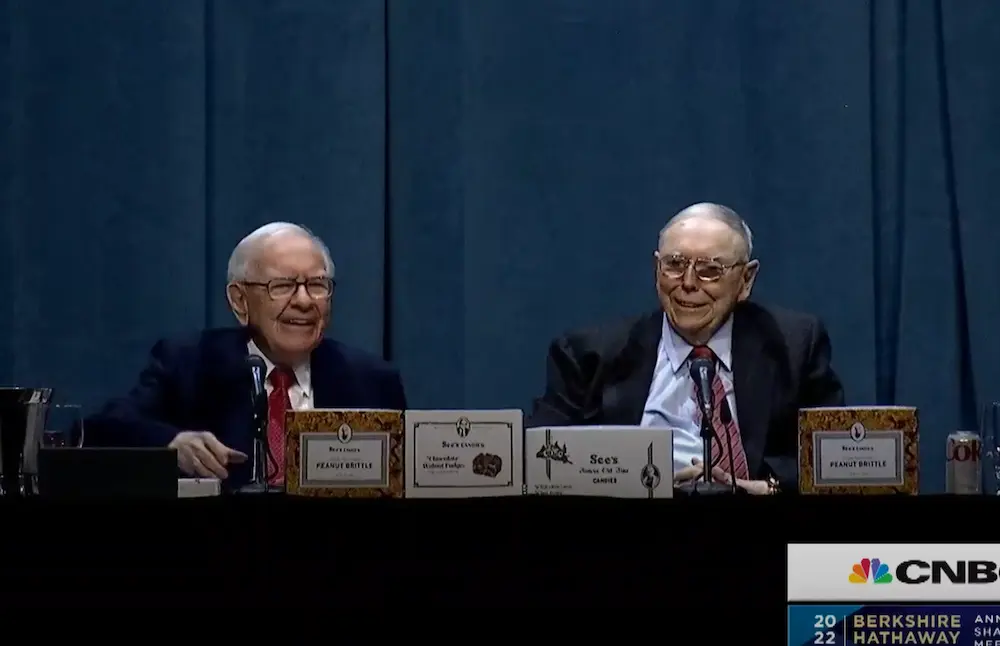
Zwei Freunde, die viele einfache Dinge verstanden haben, die aber unheimlich effektiv sind, wenn man sie langfristig und auf allen persönlichen und beruflichen Ebenen anwendet (Bildnachweis: CNBC Television)
Ein weiteres Beispiel ist mein erster Immobilien-Deal-Club, den ich gerade aufbaue. Eines der Gründungsprinzipien ist es, meine eigenen Interessen so weit wie möglich mit den Interessen der Investoren in Einklang zu bringen. Ich erfinde nichts, sondern übernehme nur die Lehren von Mentoren wie Warren Buffett (investiere dein eigenes Geld an der Seite der Aktionäre im Skin in the game-Modus), Charlie Munger (“zeige mir die Anreize und ich zeige dir das Ergebnis.”) und Jack Bogle (Vanguard strebt nicht nach Gewinnmaximierung, sondern nach Kostensenkung für seine Investoren, da diese die Eigentümer des Unternehmens sind). Es zeichnet sich also einfach dadurch aus, dass es keine unnötigen Verwaltungskosten gibt und der Einsatz mindestens so gross ist wie jeder Anleger.
Die Märkte gehen immer nach oben
Ich empfehle dir die Lektüre von diesem Artikel, wenn du eine andere Perspektive auf das Thema haben möchtest.
Ah, und eine kleine notwendige Erinnerung: Die Märkte steigen immer für den Indexanleger (wie mit dem VT-ETF), nicht für den Stock-Picking-Anleger. Ein VT-ETF profitiert von einer automatischen “Bereinigung” durch sein inhärentes Indexsystem: Unternehmen, die bankrott sind oder sich im Abwärtstrend befinden, werden aus dem Index entfernt und durch bessere Unternehmen ersetzt.
Wachstum und die Grenzen des Planeten
Ich stimme Herrn Danthine zu, wenn er sagt, dass das Geld, das nicht für Hardware ausgegeben wird, in andere Bereiche der Wirtschaft fliessen würde und dass das Wachstum nicht aufhören würde.
Ich bin optimistischer als er (zu Recht oder zu Unrecht, die Zukunft wird es zeigen). Ob es nun die Natur ist oder ein Gesetz oder ein neues Umweltmarktsystem, das menschliche Verhalten passt sich an, wenn es Einschränkungen gibt. Das haben wir während COVID gut gesehen.
Wenn wir morgen nicht mehr fliegen könnten, bin ich mir nicht sicher, ob die Wachstumsverlangsamung so enorm wäre. Er würde vor allem verlagert werden. Privatpersonen werden andere Wege suchen und finden, um ihre Freizeit zu verbringen. Dasselbe gilt für Geschäftsreisen. Unternehmen werden mehr Geld haben, um in nützlichere Dinge zu investieren als in Geschäftsreisen, die über Zoom abgewickelt werden könnten.
Auch dies ist nur eine (optimistische) Annahme unter vielen. Die Zukunft wird zeigen, wer Recht hat. Und wie immer werden wir sicherlich irgendwo dazwischen liegen.
Degrowth, nicht unbedingt eine Lösung
Ohne Politik oder Dogmatismus, dieser Satz hat mir sehr gut gefallen: “Man muss da ein bisschen agnostisch sein. Das Ziel ist nicht, zu schrumpfen. Das Ziel ist, die planetarischen Grenzen zu respektieren. Man muss intelligent sein und aufhören, sinnlos materielle Güter zu konsumieren, aufhören zu denken, dass man immer mehr arbeiten muss, um mehr zu verdienen und mehr zu konsumieren.”
So klar? Man musste schon den intellektuellen Hintergrund haben, um das so prägnant zu erklären.
Eine Rendite von 7-8%?
Vielleicht bin ich zu optimistisch (oder habe weniger makroökonomische Kenntnisse), oder ich bin jünger und habe noch zu viel Idealismus, aber ich glaube nicht unbedingt, dass das Wachstum so stark sinken wird, wie Jean-Pierre Danthine es vorhersagt.
Meine Vision ist eher eine Umleitung des Wohlstands hin zu mehr immateriellen Gütern, wenn die Mehrheit der Bevölkerung erkennt (gezwungen durch die Natur, die sich ihre Rechte zurückholt, oder andere Umweltgesetze, die Verhaltensänderungen erzwingen), dass übermässiger Konsum weder gesund noch für irgendeinen Menschen wünschenswert ist und dass es andere Wege gibt, glücklich zu sein — langfristig (und nicht durch einen Dopaminschub beim endlosen Scrollen!). Und diese Dinge werden zu Wirtschaftswachstum führen.
Nur um das klarzustellen: Nein, es wird nicht einfach sein, ein gewisses Wachstum zu erhalten, wenn man das Pariser Abkommen einhält. Aber wenn wir das Kapital klug umverteilen und auf den grünen Übergang als Innovationsmotor setzen, dann steht einem soliden Wachstum nichts im Wege.
Wir sprechen in 50 Jahren darüber!
Diversifizierung, Diversifizierung und Diversifizierung (deiner Investitionen)
Wenn du noch einen “offiziellen” Beweis von einem “echten” Ökonomen (vs. einem zufälligen Schweizer Blogger) brauchst, um alles zu bestätigen, was ich hier sage:
- diesem Artikel über wie ich CHF 10'000 investieren würde, wenn ich heute noch einmal von vorne anfangen würde
- mein Buch
- oder mein Programm, mit dem du in wenigen Wochen in den Aktienmarkt einsteigen kannst, indem du verstehst, was du tust
… hier ist sie also von einem echten, offiziellen Wirtschaftswissenschaftler: “Maximale Diversifikation ist das Einzige, was ein einzelner Investor wirklich tun kann”.
ESG und Divestment: Ja… aber nein!
Ich verstehe die Absicht hinter ESG und Divestment. Aber ich persönlich ziehe es vor, über ein gut diversifiziertes Portfolio in alle Unternehmen weltweit investiert zu bleiben (oder sollte ich sagen, über den einen und einzigen: den VT-ETF). Und ich nutze meine Zeit, um wirklich etwas zu bewirken. Dieser Blog ist ein Beispiel dafür. Andere, die erst einmal Feuer gefangen haben, entscheiden sich dafür, in nachhaltigen Unternehmen zu arbeiten. Und die Mutigsten (oder die am wenigsten Ängstlichen?) stürzen sich mit voller Kraft in das Impact Entrepreneurship.
Mein Gewissen schimpft manchmal ein bisschen, aber es kommt wieder in Ordnung. Ich will dort handeln, wo es nachweislich funktioniert. Nicht nur das tun, was die Mehrheit tut, um ihr Gewissen zu beruhigen, obwohl es am Ende nichts ändert. Nada.
Wenn du mehr Details zu diesem Thema haben möchtest, empfehle ich dir diesen bis heute gültigen Artikel.
Konflikt zwischen dem Ende der Welt und dem Ende des Monats!
Dieses Zitat hat viel mit dem Grund für diesen Blog und all meine damit verbundenen Projekte zu tun. Ich werde es zu meinem Ikigai hinzufügen:
Ich helfe dir, am Ende jedes Monats finanziell zu atmen, damit du dich dort engagieren kannst, wo es Sinn macht.
Mehr Klarheit in meinem Rentiersparadox
Um ein Rentier zu werden, musst du arbeiten. Von nichts kommt nichts. Und sobald du finanziell unabhängig bist (= Rentier = FIRE), trägst du weiterhin dazu bei, die Welt am Laufen zu halten, indem du dein Kapital zur Verfügung stellst. Auch das ist eine Form des Beitrags.
Zusammengefasst von Jean-Pierre Danthine: Es gibt nicht nur Arbeit, es gibt auch Kapital, finanzielle Mittel".
Oder wie ich mehr Klarheit über viele meiner menschlichen Paradoxien bekommen kann.
Ich danke Herrn Danthine noch einmal ganz herzlich dafür, dass er mir seine wertvolle Zeit geschenkt hat, denn er arbeitet mit Hochdruck am Weltuntergang :)
Und du? Was nimmst du aus diesem Interview mit? (Wie immer: konstruktiv und ohne Politik, bitte)

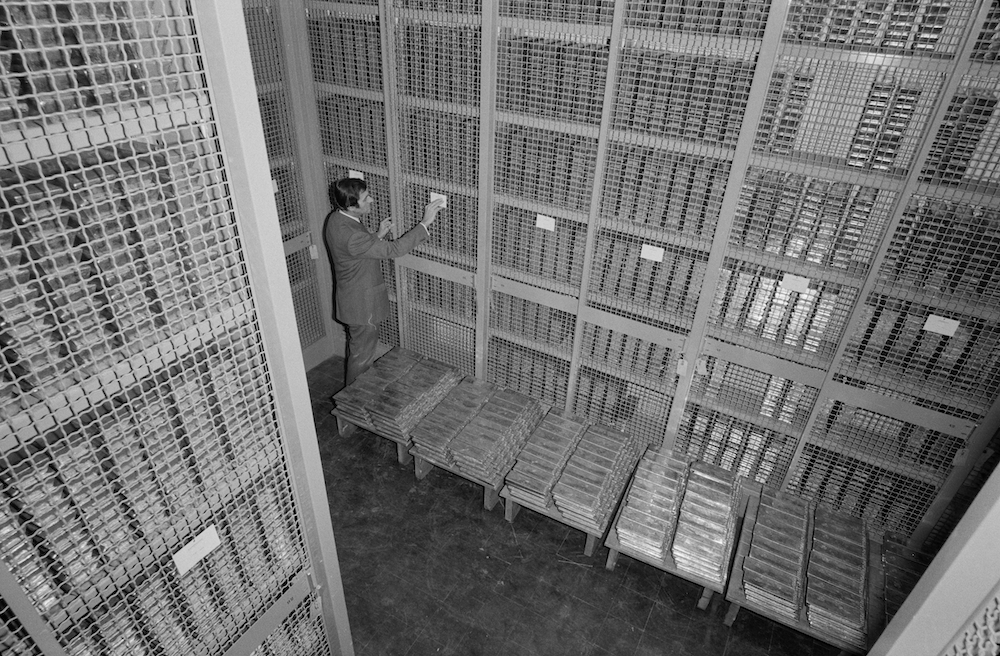





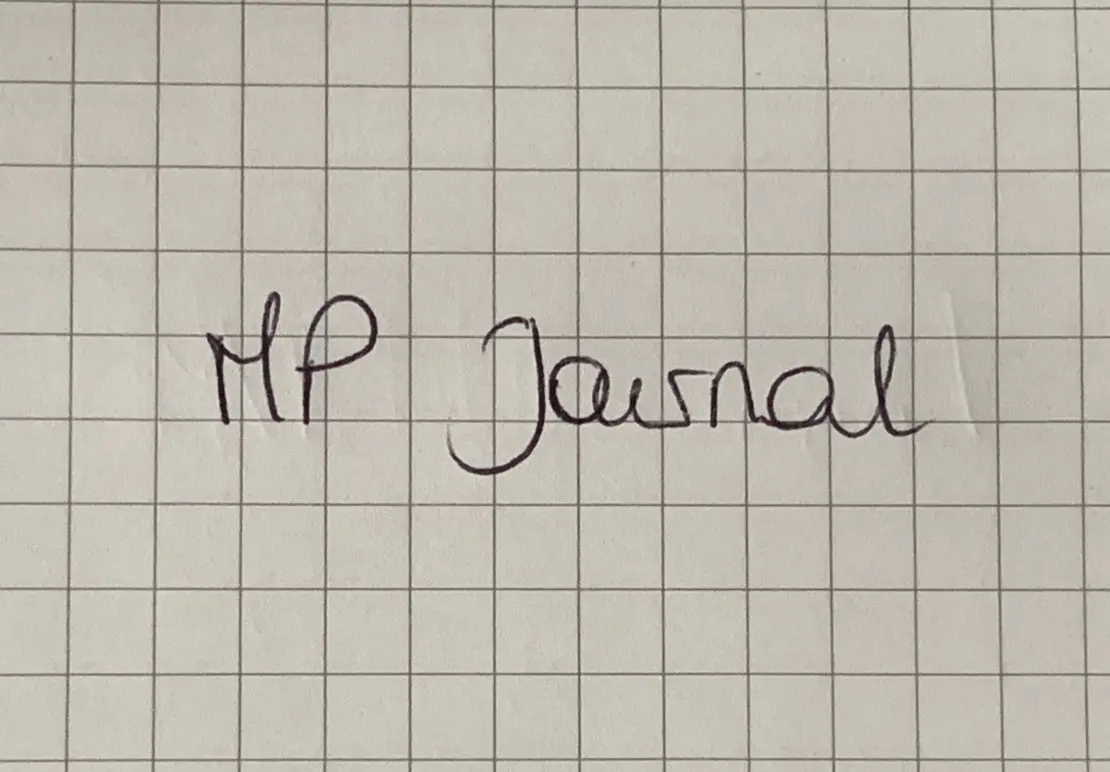
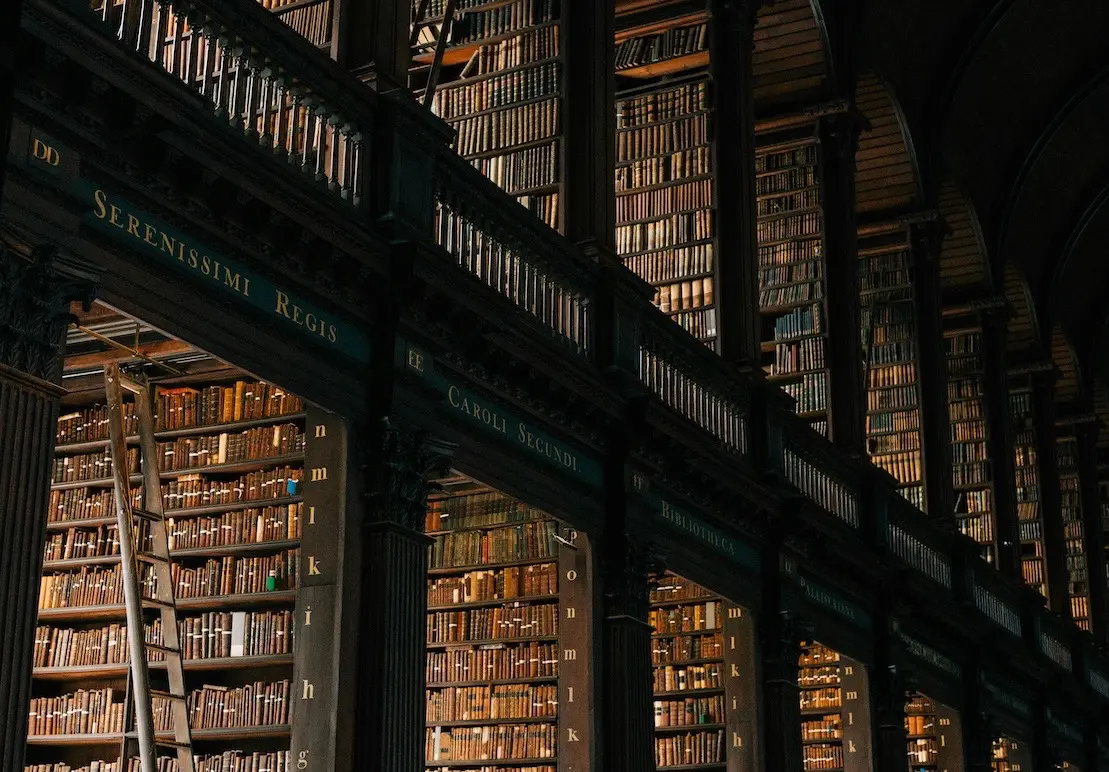
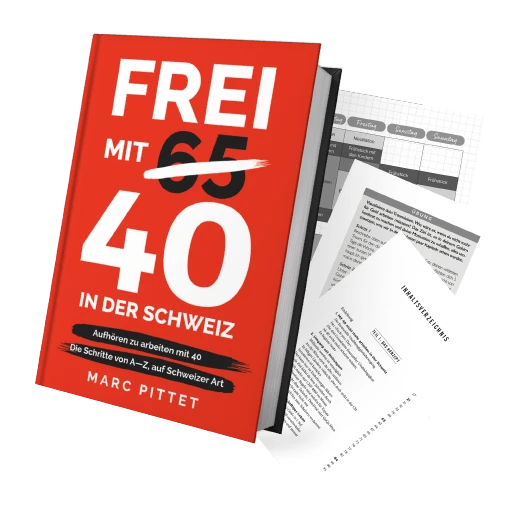
Letztes Update: 3. Juli 2025